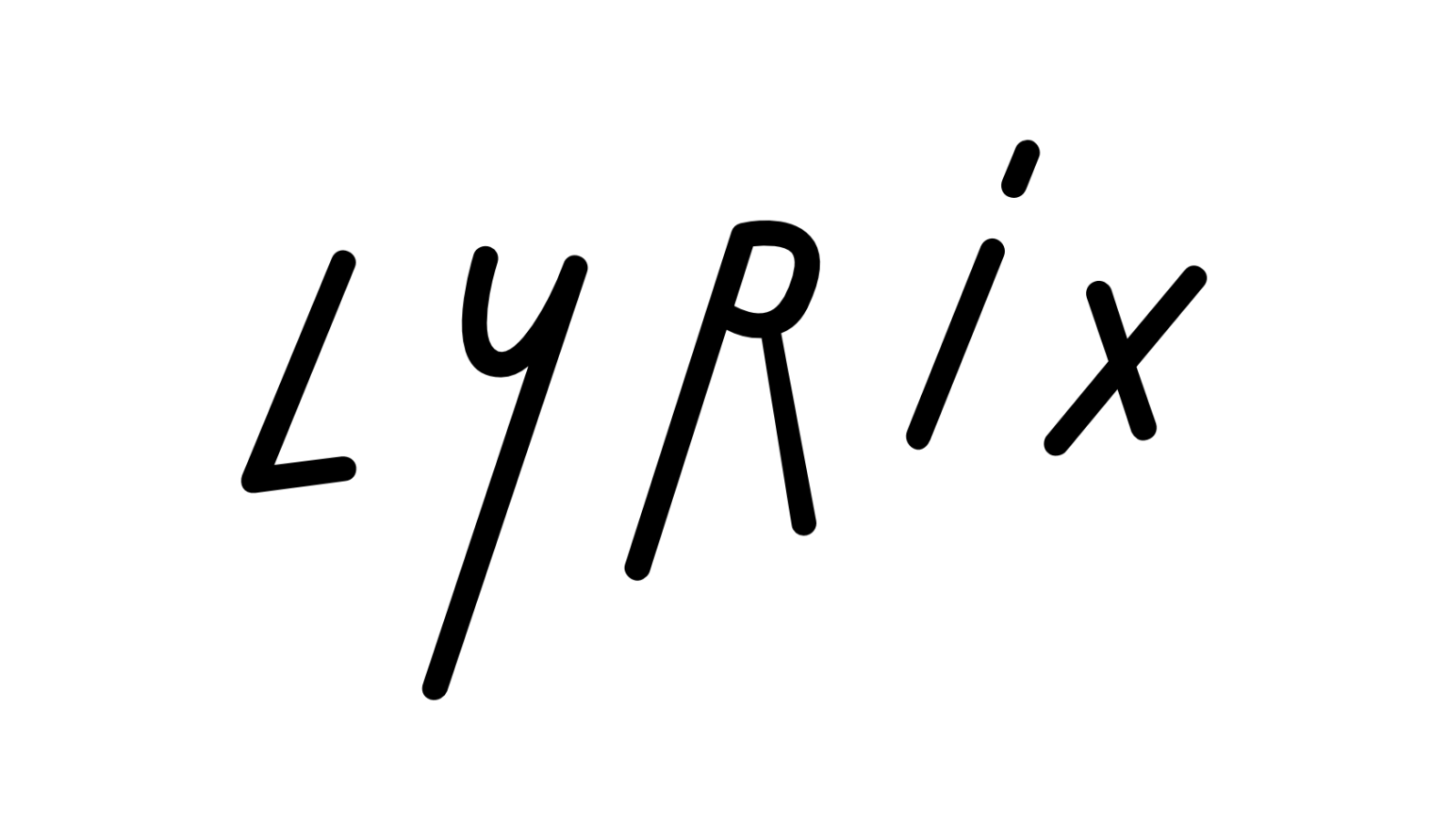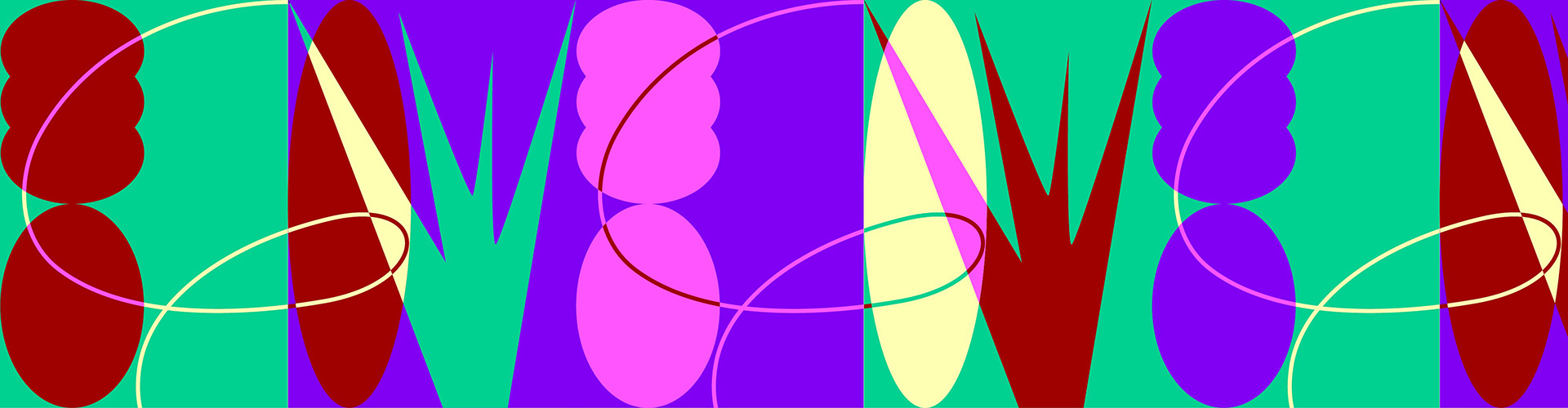Jetzt musst du springen - Teil III
Lesen – Sprechen – Durchhalten. Ein Essay der ehemaligen lyrix-Preisträgerin Josefine Berkholz über das Lesen und das Schreiben, über das Finden einer (eigenen) Sprache und über das Dichten für sich selbst und für die Öffentlichkeit.
von Josefine Berkholz
Teil III
3: JETZT MUSST DU SPRINGEN // DURCHHALTEN
Und du weißt, dass dein Vater sich fragt:
Wird er es bringen?
Und deine Mutter sagt nein.
Element of Crime
Zum Schluss ein paar willkürlich gewürfelte Ratschläge zum Durchhalten, das vielleicht sowieso das -Wichtigste ist. Ich erhebe keinen Anspruch auf Vollständigkeit, werde aber dafür so tun als wäre ich irgendwie altersweise oder etwas in der Art, was ich natürlich nicht bin. Es gilt, was der amerikanische Spokenword-Poet Buddy Wakefield in seinem Prosagedicht „The Information Man“ sagt: “I talk a whole bunch, but I really only know a few things, so I’m not saying follow along verbatim here. I’ll just tell you the things I tell myself— the things I know—and you can see what sticks”.

Manchmal, vielleicht vor allem am Anfang, passieren einem Texte. Man weiß selber nicht so genau, wie man das gemacht hat und was es eigentlich ist, und vielleicht findet man, was man geschrieben hat, nur gut, weil jemand anderes, jemand, der eine Legitimation besitzt, es besser zu wissen (Lehrer, Eltern, Literaturjurys) das gesagt hat. Dann will man das wiederholen, aber man weiß nicht wie. Oder man will einfach wie sonst auch immer ein Gedicht schreiben, weil das Spaß macht, weil es einem natürlich vorkommt oder eben ist, was man so tut, aber man kriegt auf einmal die Frage nicht mehr aus den Gedanken, ob das denn jetzt auch gut ist, den Gedanken, dass das ganz sicher nicht gut sein könne, man macht ein paar stümperhafte Kopfstände auf dem Bett¹ und hat immer noch keine Antwort und dann geht manchmal sehr schnell überhaupt nichts mehr.
Wenn man übergeht von einem intuitiven Schreiben (das, was immer mit „ich schreib eigentlich nur für mich“ bezeichnet wird), einem Schreiben also, das seine Außenwirkung nicht mitdenkt zu einem, das sich seiner selbst und der Möglichkeit von Öffentlichkeit bewusst ist, wird es schnell unheimlich. Man will eventuell dem gerecht werden, was andere da meinen, in einem gesehen zu haben. Wenn man es dabei versäumt, selber ein Verhältnis zum eigenen Schreiben aufzubauen, also für sich herauszufinden, was man an den eigenen Gedichten gut findet und was nicht, wofür man sich interessiert und wie man schreiben möchte, dann hat man ein Problem: Man wird hilflos und anfällig. Hilflos, weil einem selten jemand ein Kochrezept schreiben wird für das nächste Gedicht oder genau sagen wird, was man bitte tun und lassen soll, damit es endlich klappt, anfällig für zwei Dinge: Gemeinheiten und Gehorsam. Gemeinheiten: Wenn du eigentlich keine Ahnung hast, ob irgendwas an deinen Gedichten gut ist, dann hast du unproduktiver Kritik nichts entgegenzusetzen. Du kannst dich nicht nach außen, aber vor allem vor dir selbst nicht verteidigen. Und manchmal ist es gut, das zu können. Weil es dann eben doch manchmal Leute gibt, die dich einfach verunsichern wollen. Gehorsam: Wenn du eigentlich keine Ahnung hast, was an deinen Gedichten gut ist, läufst du Gefahr, einfach zu tun, was du glaubst, das Leute erwarten. Das macht Literatur erfahrungsgemäß langweilig und verzichtbar.
Du musst also, wenn du aufgehört hast, nur für dich zu schreiben, lernen, von dir aus zu schreiben.
Ein Ratschlag, der immer geht: “There must be quite a few things a hot bath won’t cure, but I don’t know many of them.” (Sylvia Plath)
Je professionalisierter du also schreibst, desto weniger wird das aufhören, desto mehr wird das eher schlimmer: Es tauchen Leute auf, die irgendwas von dir wollen. Du sollst ein bisschen witziger schreiben, ein bisschen upgefuckter oder authentischer oder auf gar keinen Fall mehr oder viel dezidierter für die Bühne und jedenfalls unbedingt so, dass man es in einen anderthalbseitigen Blogbeitrag kriegt und vielleicht Zwischenüberschriften, das wäre noch schön für die Lesbarkeit. Ich weiß, das ist ein schlechter Rat, weil die dich dann vielleicht nicht bezahlen und vielleicht brauchst du ja Geld für die Miete oder dringend deinen Namen auf diesem Blog oder du möchtest halt endlich mal eine Email lesen, in der steht: Liebe Frau X, herzlichen Glückwunsch! Weil du das Gefühl hast, ansonsten bald deinen Laptop zertrümmern und dein Bücherregal anzünden und eine Lehre zur Bankkauffrau anfangen zu müssen, aber: vergiss die.
Hör nur auf Leute, die dein Schreiben verstehen². Sag deinen Eltern, du studierst immer noch Kulturwissenschaften. Und dass es so ganz spannend ist, dann fragen sie eine Weile nicht nach und auch nicht, wo man denn mal was lesen kann und du hast deine Ruhe (und es ist gut, in den schlechteren Phasen, wenn man nicht alle zwei Wochen NIRGENDWO sagen muss).
Hör allerdings unbedingt auf Leute, die dein Schreiben verstehen. Egal wie schwer es ist: Sorg dafür, dass es sie gibt. Sie können dir sagen, wenn du in die falsche Richtung rennst, und irgendwo in deinem Hinterkopf kannst du beginnen, das Vertrauen zu kultivieren, dass sie das tun werden, und dann machst du dir vielleicht nicht mehr die ganze Zeit Sorgen beim Laufen.
Sie können auch liebevoll neben dir stehen, während du dir die Haare ausraufst und sagen: Guck doch mal nach links. Da ist doch dein verdammtes Thema. Oder: Lösch diese Seite bitte nicht. Beides ist sehr wichtig, weil schreiben nun mal lebensbedrohlich gruselig ist und die Autorin sich selbst fast immer ein unbarmherziges Arschloch.
Was tue ich hier eigentlich. Fuck, fuck, fuck, was tue ich hier.
Vollkommen richtig: du tippst eine halbwegs willkürliche Kombination aus Worten in ein Worddokument, für die dich vermutlich niemals jemand bezahlen wird.
Du hättest Jura studieren sollen, wie dein Vater das immer wollte.
Nicht dass ich das auf lange Lebens- und Schaffenszeit überprüfen könnte, aber ich habe den harten Verdacht: Es wird diese Tage immer geben.
Vielleicht ist es ein bisschen wie Zaubern lernen: Entweder du fuchtelst mit einem gekrümmten Stöckchen durch die Luft und murmelst Nonsens in falschem Latein, oder du bringst eine Feder zum Fliegen. Zwischen beiden Ergebnissen liegen nur minimale Unterschiede im Tun. In acht von zehn Fällen begreifst du nicht ganz, wo sie sind, und manchmal war es einfach die Tagesform. Zu deprimierend? Okay, lass mich den Fokus verschieben: Du kannst manchmal Dinge zum Fliegen bringen.³
An dieser Stelle: hör niemals, wirklich niemals auf Leute, die dir erzählen, sie schrieben ihre besten Texte, wenn sie besoffen seien, egal, wie lange sie dir schon am Bartresen die Ohren vollsabbern, weil dir rausgerutscht ist, dass du schreibst. Es stimmt nicht. Und wenn es stimmt, dann nur, weil sie ausschließlich schreiben, wenn sie besoffen sind, und niemals gut. Glaub ihnen auch nicht, dass Hemingway nie überarbeitet hätte. Auch das stimmt nicht.
Es klingt unromantisch und ein bisschen so, als befändest du dich doch aus Versehen in einer Lehre zur Bankkauffrau (nur ohne Geld), aber: Schreiben ist auch Arbeit. Und das ist auf den zweiten Blick ermutigend. Es bedeutet nämlich, dass du nicht verloren bist, wenn dir nicht auf Anhieb ein perfektes Gedicht aus dem Unterarm fließt. Du kannst erstmal runterschreiben, und dann kannst du daran arbeiten. Du kannst ein heißes Bad nehmen. Du kannst haufenweise gute Gedichte lesen und versuchen zu verstehen, was du an ihnen magst. Du kannst Leute suchen, die dein Schreiben verstehen, und dich von ihnen in den Arm nehmen oder in den Arsch treten lassen. Du kannst dranbleiben, und versuchen, durchzuhalten, und dich wieder und wieder trauen. Du kannst ja doch nicht anders, sonst würdest du den Unsinn nicht machen. Ich glaube, Schreiben wird nie aufhören ein völlig unzumutbares Wagnis zu sein. Aber so ist das halt. [Jetzt musst du springen.]
¹Oder was auch immer da deine Methode ist. Mein Kollege D. zum Beispiel macht immer Handstand, aber der war auch mehrere Jahre lang Turner und hat da ganz andere Möglichkeiten.
²Das bedeutet nicht, dass du nicht mal was ausprobieren kannst oder den Text halt mal so kürzen, dass er in die Form passt. Aber lass das Pragmatische nicht überhand nehmen.
³Herauszufinden, warum die scheiß Feder denn jetzt nicht geflogen ist, ist natürlich essentiell und die einzig vernünftige Antwort auf die bescheuerte Frage, ob man denn Schreiben lernen könne. Auch wenn es manchmal schwer ist.
Die Antwort darauf wiederum hat hübscherweise mit Metrik zu tun und lautet natürlich: Es heißt „Win-gar-dium Levi-o-sa“, und man muss das gar schön und lang machen.
Josefine Berkholz wurde 1994 in Durham, North Carolina geboren und lebt in Bochum. Sie schreibt Lyrik, Dramatik, Performatives und Nonfiction.
In den letzten Jahren viel Kollektivarbeit, meistens in spartenübergreifenden Projekten, als letztes das Theaterstück „Die Armstronggrenze“ (mit Thomas Kaschel, Schauspieler und Tristan Berger, Producer&Komponist) und das Spokenword/Rap/Musik-Projekt „Betroit“ (mit Künstler*innen aus Detroit und Berlin).

Seit 2010 fester Bestandteil der deutschsprachigen Poetry Slam Szene, Auftritte in Russland, Brasilien, den USA und Kenia und in deutschen Käffern, Texte u.a. beim 21. Treffen junger Autoren, bei 4+1 – Ein Treffen junger AutorInnen, in Zeitschriften und in Anthologien. 2013-2017 Studium am Deutschen Literaturinstitut Leipzig.