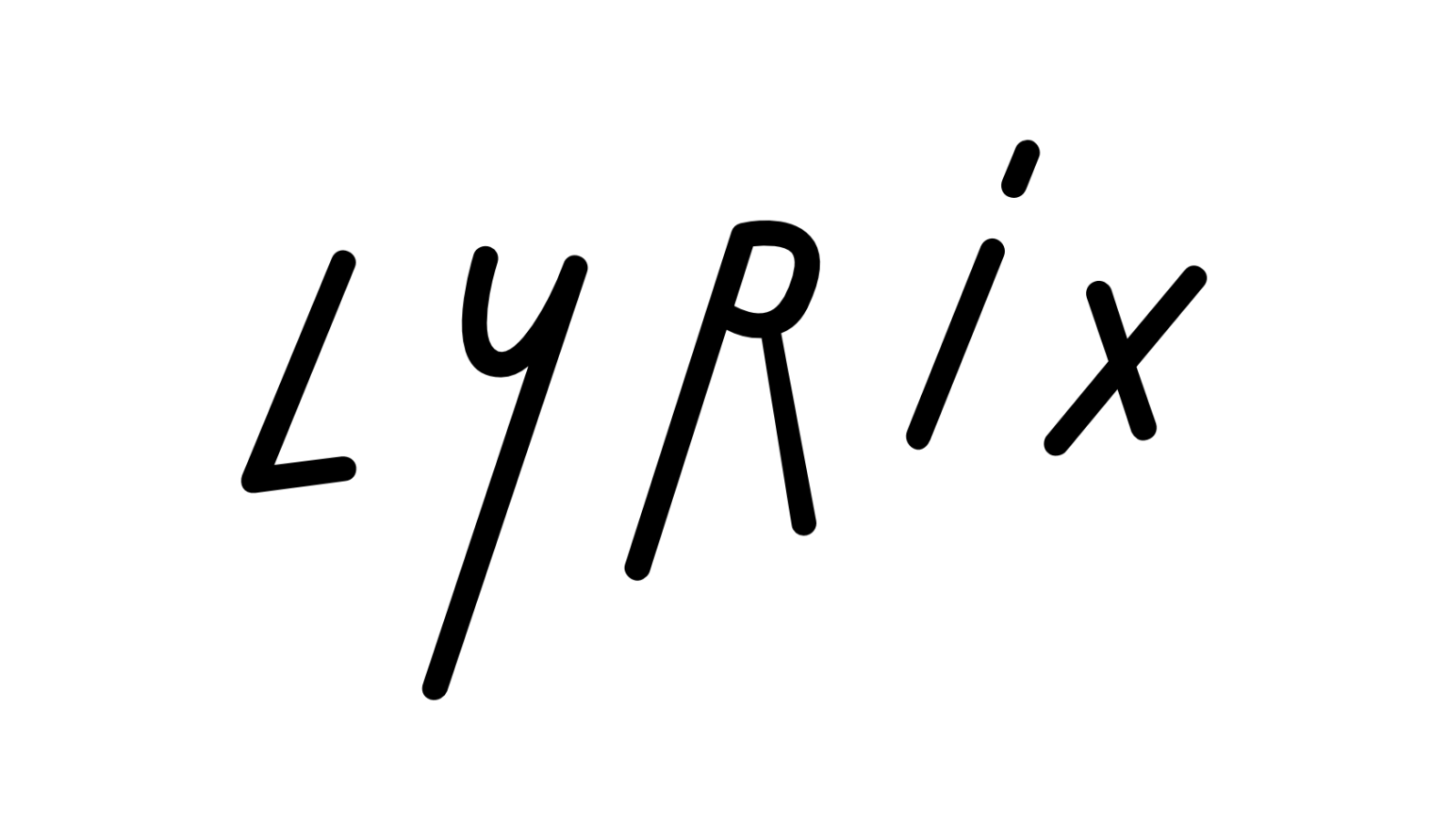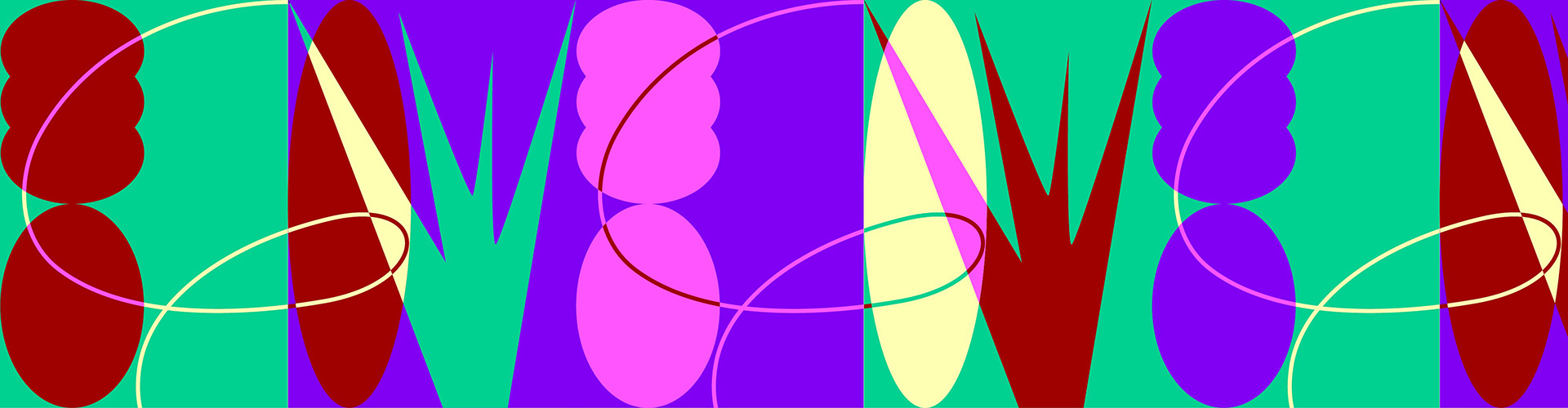Jetzt musst du springen - Teil II
Lesen – Sprechen – Durchhalten. Ein Essay der ehemaligen lyrix-Preisträgerin Josefine Berkholz über das Lesen und das Schreiben, über das Finden einer (eigenen) Sprache und über das Dichten für sich selbst und für die Öffentlichkeit.
von Josefine Berkholz
Teil II

2: DU BIST HIER NICHT EINFACH EIN FREUND // SPRECHEN
Für mich war das Schreiben, neben so vielem anderen, auch immer der Versuch, eine ehrliche Sprache zu finden. Denn es ist nun mal so: Sprache ist (auch) Gebrauchsgegenstand. Wir nennen Dinge irgendwie, und dann reichen uns andere die Butter, nicken verständnisvoll mit dem Kopf oder sagen, dass sie uns auch lieben.
Weil das oft funktioniert oder zumindest so aussieht, fallen Leute immer wieder dem Irrtum anheim, man müsse sprechen nicht lernen, wie man etwa ein Instrument lernen muss. Das stimmt natürlich nicht. Feste Bezeichnungen können praktikabel sein, und ich will nicht sagen, dass es das Frühstück irgendwie besser macht, eine sprachtheoretische Diskussion um die Milchprodukte loszutreten (obwohl ich auch das schon erlebt habe). Aber manchmal muss eben mehr oder etwas ganz und gar anderes bezeichnet werden als Butter. Etwas Eigeneres vielleicht, oder etwas weniger Konkretes. Es wurde schon erwähnt: Man kann manchmal in guten Texten oder durch sie eine Sprache verliehen bekommen für diese weniger fassbaren Dinge. Man kann aber auch daran arbeiten, selber sprechen zu lernen. (Lesen hilft dabei, wie bei einer Menge mehr. Das ist hier kein Entweder-oder).
Der immer noch wichtigste Ratschlag, den ich jemals in einer Schreibwerkstatt bekommen habe, stammte von Norbert Hummelt¹ und lautete: Sei konkreter. Im Detail war es die Anweisung, alle Abstrakta in meinem Gedicht zu streichen und jeweils durch etwas Konkretes zu ersetzen. Das Ergebnis war ein ziemlich verblüffender Prozess: Dadurch, dass ich plötzlich nicht mehr „Sehnsucht“ „Herz“² und „Angst“ schreiben konnte, musste ich mich fragen, was ich denn eigentlich wirklich – ganz genau – meinte. Und wie es sich beschreiben ließe, so, dass es trifft. Ich musste mich von einer irgendwie wabernden „Gedichtsprache“ an meine eigene Sprache heranhangeln.
Eine solche Präzision macht nicht nur Gedichte besser. Sich zu fragen, wie man die Dinge um sich her wahrnimmt und zu versuchen, sie für sich adäquat zu benennen, bedeutet auch, sich sprachlich einen Raum zu schaffen, in dem man vorkommen kann.
Eine eigene Sprache finden schärft das Denken, die Perspektive, die Möglichkeit, sich mitzuteilen und überhaupt da zu sein. Nur so kann ich – für mich – vollständig herausfinden, was in mir ist, was ich wirklich denke, wie ich tatsächlich die Welt sehe, nicht, wie sie mir beschrieben wurde. Ein solches Schreiben, ein solches Sprechen ist inhärent widerständig, weil die Art, wie wir denken, die Welt beurteilen und begreifen, ob wir etwas für wichtig oder unwichtig halten, für tot oder belebt, nun mal aus Sprache besteht oder zumindest durch sie in der Welt auftaucht.
Es ist also richtig, sich immer und immer wieder zu fragen: Ist das ein Baum? Ist das die Farbe des Himmels? Ist das jetzt wirklich Punk? Und was bedeutet es, wenn ich diese Sache so nenne? Ist dieser Name zärtlich oder wertneutral, beschreibt er ein Ding oder etwas Belebtes, wie fühlen sich seine Laute in meinem Mund an? Kann ich das Wort ausspucken? Warum ist das so, und, nicht zuletzt: Könnte ich dieses Ding auch anders nennen?
Wenn ich zum Beispiel einen schönen Menschen als Blume beschreibe. Was ist eine Blume? Und was ist sie noch? Viele Blumen sind schön. Alle Blumen sind zum Beispiel nicht fähig zu Sprache. Blumen sind oft Dekoration. Wenn ich dich eine Blume nenne – tue ich das, weil du mich wirklich an eine Blume erinnerst? Oder weil andere vor mir andere Menschen mit Blumen verglichen haben? Woran erinnert mich deine Schönheit denn nun wirklich? Ist sie rein dekorativ?
Gute Gedichte entstehen aus der Vermeidung solcher Klischees, weil das Klischee letztlich immer überhaupt nichts bezeichnet, außer sich selbst.
Wenn ich den expliziten Menschen beschreibe, den ich explizit liebe, für seine obszöne, rasante, nicht-dekorative Schönheit, dann mag sich das wie etwas zu Privates anfühlen. Als läse ich anderen mein Tagebuch vor, und was sollen die damit anfangen, wo die dich doch gar nicht kennen, gar nicht wissen können, was ich meine, wenn ich sage, dass mir das richtige Verb fehlt um zu beschreiben, wie dein Glück aus dir raussprudelt in manchen Momenten und wie ich dir ewig lang auf die Unterarme starre, während du meinen Lieblingsgedichtband liest, und mir das locker noch die nächste Stunde Beschäftigung sein könnte. Aber vielleicht erzählt man, in dem man so etwas nennt, eben nicht nur von einem schönen Unterarm. Darin ist das Gedicht eben mehr als Tagebuch, mehr als konventionelle Sprache: Die Worte in einem Gedicht bilden mehr als die Summe ihres Bezeichneten. Das nicht ganz Subsumierbare, das ich durch das konkret Genannte erzähle, ist trotzdem präsent. Und das Gute ist: Es ist nicht fest.
Vielleicht ist es die Erfahrung, jemanden genau in dem neugierigen Stadium zu lieben, in dem einem so etwas auffällt, vielleicht geht es eigentlich viel mehr um den Gedichtband, vielleicht ist es etwas ganz anderes und der Unterarm steht hier für etwas weit außerhalb seiner selbst. Sag du es mir, Leserin. Es gibt darauf unzählige Antworten, und alle stimmen.
Es geht also nicht darum, einfach hübsch zu kodieren was man als Autorin sagen will, und als Leser diesen Code zu knacken. Es geht um Lücken, und darum, dass in ihnen bei jedem Lesen das Gedicht neu, oder eher ein neues Gedicht entsteht. Es geht um Vieldeutigkeit und Präzision, die zusammen wiederum jemand anderem eine Sprache verleihen können, auch wenn man den gar nicht kennt.
Vielleicht bist du dann irgendwann alt und hunderte Kilometer von dir entfernt denkt ein halbfertiger Mitzwanziger, dass du als einziger ihn wirklich verstehst. Das kannst du dann niedlich und ein bisschen bemitleidenswert finden, und sehr darüber freuen kannst du dich auch noch. Weil er da ja dann irgendwie Recht hat, der Mitzwanziger, auch wenn vielleicht nicht direkt du ihn verstehst, sondern dein Gedicht. Aber du hast es ja immerhin geschrieben.
¹Das war tatsächlich in meiner ersten lyrix-Werkstatt. Ich schwöre.
²Es gibt natürlich konkrete Herzen, aber ich hatte nicht über diesen faustgroßen Supermuskel geschrieben, der macht, dass alles in unsere Körpern funktioniert, sondern über irgendwasmitgefühlen.
Josefine Berkholz wurde 1994 in Durham, North Carolina geboren und lebt in Bochum. Sie schreibt Lyrik, Dramatik, Performatives und Nonfiction.
In den letzten Jahren viel Kollektivarbeit, meistens in spartenübergreifenden Projekten, als letztes das Theaterstück „Die Armstronggrenze“ (mit Thomas Kaschel, Schauspieler und Tristan Berger, Producer&Komponist) und das Spokenword/Rap/Musik-Projekt „Betroit“ (mit Künstler*innen aus Detroit und Berlin).

Seit 2010 fester Bestandteil der deutschsprachigen Poetry Slam Szene, Auftritte in Russland, Brasilien, den USA und Kenia und in deutschen Käffern, Texte u.a. beim 21. Treffen junger Autoren, bei 4+1 – Ein Treffen junger AutorInnen, in Zeitschriften und in Anthologien. 2013-2017 Studium am Deutschen Literaturinstitut Leipzig.